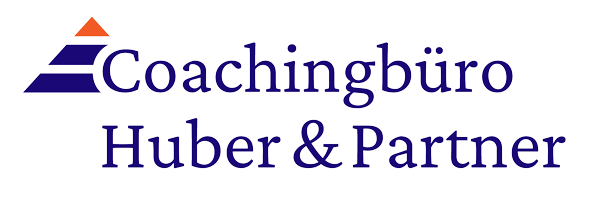Artikel von Hans-Georg Huber und Hans Metzger in Manager-Seminare
Führungskräfte sind Entscheider, die sagen, wo`s langgeht. Doch das allein reicht nicht. Heute ist von ihnen eine weitere Rolle gefordert – die des team-orientierten Entwicklungshelfers. Als solcher aber brauchen die „Machthaber“ neue Tugenden, nämlich: Demut und Bescheidenheit.
„Wer Menschen führen will, muss hinter ihnen gehen.“ Das predigte schon der chinesische Philosoph Laotse. Bezogen auf Führungskräfte gilt seine Weisheit heute, rund 1.600 Jahre später, mehr denn je. Genauer gesagt: Diese Weisheit ist wieder aktuell. Zwar war es vor nicht allzu langer Zeit noch wichtig, als Führungskraft oder Unternehmer wie ein Leithammel vorneweg zu laufen und gleichzeitig, wenn nötig, wie ein Fels in der Brandung zu stehen. Doch in der heutigen Zeit reicht das nicht mehr aus.
Führungskräfte sind nicht mehr nur als Tonangeber gefragt, die alleine bestimmen, was, wie und mit welchen Instrumenten „gespielt“ wird. Denn isolierte Entscheidungen und Problemlösungen werden den Anforderungen des sich laufend wandelnden Marktes nicht mehr gerecht. Um Lösungen zu erzielen, gilt es viel-mehr, Synergie-Effekte zwischen allen Beteiligten herzustellen. Und das bedeutet: Dem autoritären Führungsstil wird zunehmend der Nährboden entzogen. Im Sinne Laotses müssen Führungskräfte lernen, ihre Mitarbeiter mehr in den Vordergrund zu stellen und sich selber stärker zurückzunehmen.
Weit verbreitet: die Angst vor Machtverlust
Für viele Führungskräfte stellt diese Forderung eine starke Bedrohung dar – was nicht zuletzt ein gern erzählter Witz illustriert: „Suchen Sie“, beauftragt der Finanzchef eines Unternehmens seinen Assistenten, „im ganzen Unternehmen nach einem jungen, dynamischen, karriereorientierten Mitarbeiter, der alle Qualitäten dafür besitzt, meinen Job zu machen… und schmeißen Sie ihn dann raus!“ Was dieser Witz beschreibt, ist die oft mit Macht verbundene Angst, eben diese Macht zu verlieren. Noch immer versuchen viele Vorgesetzte, ihre Mitarbeiter klein zu halten, um sich nicht die eigene Konkurrenz heranzuzüchten oder den Mitarbeiter, der sich als besonders tüchtig erweist, an eine andere Abteilung zu verlieren. Die Angst vor Machtverlust ist jedoch nicht ganz unberechtigt, verlangt der Wandel doch Fähigkeiten, über die Führungskräfte nicht zwangsläufig verfügen. Und diese Fähigkeiten haben nicht unbedingt etwas mit „Macht“ zu tun – zumindest nicht mit Macht im Sinne einer ganz und gar autoritären, statusbedachten und egoistischen Ausübung derselben.
Zum Beispiel wird von Führungskräften heute Teamfähigkeit erwartet. Statt weiter der „tolle Hecht im Karpfenteich“ zu sein, müssen Führungskräfte sich plötzlich als Partner in einem Team erweisen – wenn auch in einer besonderen Rolle. Statt (nur) zu herrschen, sollen sie plötzlich (auch) einem Team dienen, indem sie ihre Mitarbeiter befähigen, deren Kompetenz optimal einzubringen. Doch auch, wenn Teamkompetenz in fast jeder Stellenausschreibung für Führungskräfte als Anforderungsmerkmal gelistet ist – in der Praxis ist es für die Karriere oft unzuträglich, wenn sich Führungskräfte tatsächlich als Teamplayer erweisen.
Dem Team nutzen und so die Karriere gefährden?
Letzteres zumindest behaupten manche Trainerkollegen, die bei Topmanagern die tatsächlichen Erfolgsfaktoren für deren Karriereweg herausfilterten. Ihre Argumentation: Teamplayer zu sein ist eher hinderlich für die Karriere, weil die eigene Leistung nicht im Vordergrund steht. Wer sein eigenes Licht unter den Scheffel der Teamleistung stellt, läuft Gefahr, ein Schattendasein zu führen und bei der nächsten Beförderung übersehen zu werden. Gleichzeitig werden erfolgreiche Teams nur ungern auseinander gerissen, d.h.: Die Führungskraft bleibt möglicherweise in ihrem Team hängen, statt einen weiteren Karriereschritt zu machen und somit zu noch mehr Macht zu gelangen.
Aber auch der Faktor Geld ist nicht zu unterschätzen. Wo sich Leistungstransparenz und Leistungsbezahlung bedingen, wird es für viele Vorgesetzte schwierig, den Erfolg mit ihrem Team zu teilen. Dazu kommt der mögliche Statusverlust, der für die Führungskraft besonders dann bedrohlich ist, wenn sie ihr Selbstwertgefühl und damit auch ihre Identität mit Status und Statussymbolen verknüpft hat. Aus all diesen Gründen entstehen für Führungskräfte eine ganze Menge persönlicher, ja manchmal auch moralischer Dilemmata zwischen „Was ist gut für mich?“, „Was ist gut für das Unternehmen?“ und „Was ist gut für das Team?“
Sinnsuche als Ausweg aus dem Dilemma
Die Kernfrage aber lautet: Wenn Führungskräfte dadurch all das verlieren können, was ihnen vorher wichtig war – warum sollten sie sich dann in den Dienst ihres Teams stellen? Dafür gibt es auf Dauer nur einen einzigen triftigen Grund: weil sie sich auf diese Weise einer größeren Sache widmen, die so attraktiv ist, dass es sich lohnt, dafür über den eigenen Egoismus hinauszugehen, der in jedem Menschen angelegt ist. Mit anderen Worten: Führungskräfte der Zukunft müssen für sich eine konstruktive Verbindung von Sinn und Erfolg ihrer Tätigkeit herstellen können, weil es auf Dauer die einzige Möglichkeit ist, aus ihrem Dilemma auszusteigen.
Die Orientierung an einer „größeren Sache“ erfordert jedoch u.U. einen Wertewandel. Sie erfordert neue Beweggründe, die dem Karrierestreben zu Grunde liegen. Denn für Teamfähigkeit ist nun einmal sowohl die Bereitschaft als auch die Fähigkeit essenziell, das Eigenwohl in ausreichendem Maße dem Gemeinwohl unterzuordnen. Ein Mensch, der den Sinn seines Lebens vor allem darin sieht, möglichst viel Geld, Macht und Status anzuhäufen, kann dies nicht. Ein Mensch, der hingegen sein Potenzial ausschöpfen will, der mit seiner Arbeit und seinem Engagement auch etwas Positives für die Allgemeinheit bewirken will, tut sich damit wesentlich leichter.
Eine neue Managertugend: die Fähigkeit zu dienen
Vor allem tut er sich dann leichter, wenn er in einem Unternehmen tätig ist, das eine ähnliche Richtung verfolgt. Die Motivation desjenigen, der einen tieferen Sinn sucht, lautet: „Wie kann ich mit meiner Arbeit am meisten bewirken?“, statt „Wie erwerbe ich am schnellsten Geld, Macht und Status?“ Die Unterordnung unter einen höheren Zweck verlangt zudem völlig neue Tugenden, wie etwa die Fähigkeit zu dienen, Bescheidenheit, ja manchmal auch Demut – Begriffe, die manche Menschen in Führungspositionen fürchten wie der Teufel das Weihwasser.
Das Bindeglied zwischen Unternehmen, Führungskraft und Mitarbeitern ist bei der an höheren Zwecken ausgerichteten Führung heute vor allem das gemeinsame Streben nach sinnvollem Erfolg. Die Führungskraft ist in diesem Kontext in der Position eines „Sinnbeauftagten“ verantwortlich dafür, ihren eigenen Sinn zu klären, Sinn im Unternehmen einzufordern und den Mitarbeitern den Sinn ihrer Tätigkeit nahe zu bringen.
Doch diese Funktion allein reicht für eine Neudefinition von Führung heute nicht aus. Vielmehr gilt es heute, als Führungskraft zwei verschiedene Rollen einzunehmen und je nach Situation mal in die eine, mal in die andere Rolle zu schlüpfen. Einerseits heißt es, in der Rolle des „Entwicklungshelfers“ Sinn zu stiften und Entwicklung zu ermöglichen.
Denn im Idealfall sind Unternehmen, Führungskräfte und Mitarbeiter in einem kontinuierlichen Entwicklungsprozess, der parallel mit der Entwicklung von Gesellschaft und Markt verläuft oder ihr sogar ein Stück voraus ist. Es entsteht eine Lernkultur, bei der es vor allem darum geht, sich immer wieder sehr schnell auf die sich verändernden Bedingungen einstellen zu können und an diesen zu wachsen. Andererseits kommt es für Führungskräfte darauf an, als „Entscheider“ Ziele vorzugeben, Entscheidungen zu treffen, Kontrolle auszuüben und Grenzen zu setzen.
Die Führungskraft übernimmt gegensätzliche Rollen
Beide Rollen – die des Entwicklungshelfers und die des Entscheiders – sollten den gleichen Stellenwert besitzen. In der einen Situation ist es wichtig, klare Vorgaben zu machen, in der nächsten Situation eher die Rolle eines Katalysators anzunehmen, der Prozesse fördert, ohne selbst aktiv einzugreifen. Von einer Führungskraft verlangt dies eine hohe Rollenflexibilität. Das ist nicht immer leicht, erfordert es doch zu erkennen, welches Verhalten in welcher Situation angebracht ist, und darüber hinaus die Bereitschaft, sich immer wieder in Bereiche von innerer Ambivalenz hineinzubegeben, die es auszuhalten gilt.
Die Ambivalenz tritt zwangsläufig auf, denn stellt man die beiden Rollen als „Entwicklungshelfer“ und als „Entscheider“ einander gegenüber, wird deutlich, dass sie nahezu diametral entgegengesetzt sind: Der Entwicklungshelfer dient, der Entscheider herrscht. Ersterer vertraut den Mitarbeitern und versteht Fehler als Lernchance. Zweiterer kontrolliert und betrachtet Fehler als Katastrophen. Ersterer erörtert Fragen, zweiterer liefert Antworten. Der Entwicklungshelfer erschließt Ressourcen, der Entscheider überbrückt Defizite.
Der situative Wechsel zwischen den beiden Rollen ist nicht nur herausfordernd – es besteht durch ihn auch eine Gefahr. Nämlich die, dass die Führungskraft in den Augen ihrer Mitarbeiter unglaubwürdig wird, wenn sie z.B. das eine Mal dient und das nächste Mal herrscht. Die Mitarbeiter können den Rollenwechsel schnell als Führung nach dem „Wischiwaschi-Prinzip“ einstufen und als Förderung von zusätzlichem Chaos. Damit dies nicht geschieht, müssen mehrere Voraussetzungen erfüllt sein:
- Vertrauen und Autorität sind geschaffen.
- Die Ziele und Werte, an denen sich die Führungskraft orientiert, sind bekannt und werden von den Mitarbeitern geteilt.
- Es herrscht eine Atmosphäre, in der Mitarbeiter ihre Meinung vertreten können.
- Ein ausreichendes Maß an Offenheit und Konfliktfähigkeit ist vorhanden.
Aufgaben als Entscheider und als Entwicklungshelfer
Auf dieser Basis ist die Ausfüllung der Rolle als Entscheider dann der stabile Rahmen, in dem Entwicklung stattfinden kann. Der Entscheider definiert und verteidigt die Regeln, indem er das Spielfeld für Kreativität und Selbstverantwortung definiert. Ein gesundes Verhältnis zwischen der Rolle des Entscheiders und der des Entwicklungshelfers ist dabei essenziell. Wird die Rolle als Entscheider zu wenig wahrgenommen, ist zielgerichtete Entwicklung unmöglich, weil die Orientierung fehlt. Wird sie hingegen zu massiv eingenommen, sind die Regeln zu starr und zu eng, und dies verhindert jede Entwicklung.
Entwicklungsprozesse in einem Unternehmen oder einer Abteilung anzuschieben erfordert einen relativ hohen Aufwand, vergleichbar mit dem Versuch, einen Reifen mit der Hand zu beschleunigen. Sobald dieser Prozess jedoch einmal in Gang gebracht wurde, gilt es, ihn mit wesentlich weniger Aufwand kontinuierlich am Rollen zu halten und zu verhindern, dass er wieder zum Stillstand kommt. Versucht man den Reifen zu sehr zu beschleunigen, erreicht man einen Punkt, an dem genau das Gegenteil passiert. Statt das Tempo zu erhöhen, bremst man die Bewegung ab (Free-Wheeling- Prinzip).
Dasselbe gilt für Führungskräfte: Sie müssen bei der Förderung von Entwicklungsprozessen im Unternehmen das richtige Maß kennen. Als Change-Manager brauchen sie daher neben den üblichen Führungskompetenzen ein grundlegendes Verständnis davon, wie Entwicklungsprozesse funktionieren, wie man sie initiiert, wie man die Menschen zur motivierten Teilnahme einlädt, wie man den Prozess am Laufen hält und wie man dafür sorgt, dass erkennbare Ergebnisse dabei herauskommen. Zudem müssen Führungskräfte verinnerlichen: Entwicklung bedeutet, dass parallel zu dem Erarbeiten von äußeren messbaren Ergebnissen auch ein Zuwachs an Kompetenzen, Engagement, Verantwortlichkeit und Kultur angestrebt wird, z.B. durch die Förderung einzelner Mitarbeiter, die Entwicklung des Teams, durch Konfliktmoderation, Strategieworkshops, Beurteilungs- und Zielvereinbarungsgespräche.
Abhängig davon, wie viel Gewicht dem Entwicklungsaspekt gegeben wird, kann das Verhalten der Führungskraft in einer bestimmten Situation unterschiedlich aussehen. Beispiel: Zwei Mitarbeiter haben einen Konflikt und wenden sich damit an die Führungskraft. Diese kann nun
1) in der Rolle des Entscheiders…
- eine Entscheidung herbeiführen: „Ich verlange von Ihnen, dass Sie …“
- Position beziehen: „Ich bin der Meinung, …“
2) in der Rolle des Entwicklungshelfers…
- Vertrauen geben: „Ich traue Ihnen das zu, dass Sie das selber hinbekommen.“
- Unterstützung anbieten: „Was brauchen Sie von mir, damit…“
Für jede dieser Richtungen spricht einiges. Es gibt keinen Königsweg, weil die Entscheidung von der konkreten Situation abhängt und damit von einer Vielzahl von Faktoren. Bei der flexiblen Rollenwahrnehmung ist also ein hohes Einfühlungsvermögen und viel Fingerspitzengefühl notwendig, um konstruktiv und adäquat mit der jeweiligen Situation umzugehen. Die wesentlichen Ressourcen dafür liegen in der Persönlichkeit der Führungskraft. Und die muss sich vor allem klarmachen: Die Entscheidung, ob die eine oder andere Rolle einzunehmen ist, sollte nicht von der Frage abhängen, welches Verhalten die eigene Macht vergrößert. Sondern von den Fragen: Was macht Sinn? Und was stiftet Sinn?
Hans-Georg Huber, Hans Metzger
Bei dem Artikel handelt es sich um ein angepasstes Kapitel aus dem Buch von Hans-Georg Huber / Hans-Metzger, „Sinnvoll erfolgreich – sich selbst und andere führen“